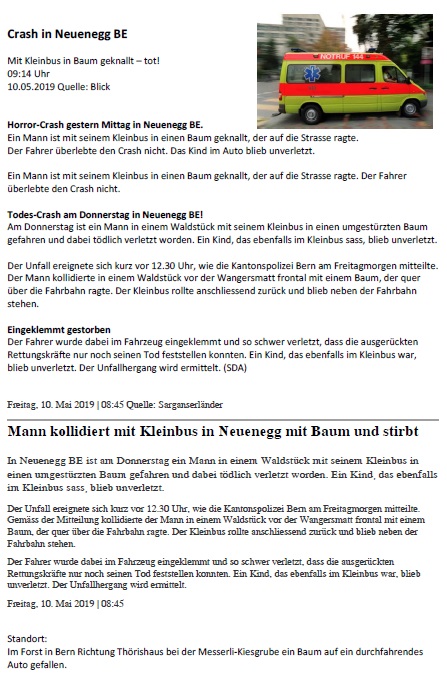Hauptseite
News
Presse
FAQ
Projekte
Poya-Brücke
Geschichte
Zweck
Infos
Anmeldung
Links
|
2024
Freiburger
Gemeindeparlamente erhalten nicht mehr Kompetenzen 

Freiburg
wird neben Solothurn der einzige Kanton bleiben,
der allein den Gemeinderäten die Kompetenz gibt, lokale
Ortsplanungen zu verabschieden. Keystone-SDA, lp, sda 08.10.2024
Die Revision
des Raumplanungs- und Baugesetzes ist am Dienstag im Freiburger Grossen Rat
durchgefallen. Mit der Revision hätten die Gemeindeparlamente die Kompetenz
erhalten, eine Ortsplanung zu erlassen.
Die Gemeindeexekutiven hätten die
Ortsplanungsrevisionen nur noch geleitet.
Das Eintreten
auf das Gesetz wurde am Dienstag nach langen Diskussionen mit 64 zu 40 Stimmen
bei einer Enthaltung abgelehnt.
Die Debatten zeigten die Uneinigkeit im Plenum,
wobei sich grosse und kleine Gemeinden gegenüberstanden.
Die Vorlage
der Regierung, die vom Direktor für Raumentwicklung und Umwelt, Staatsrat
Jean-Fançois Steiert verteidigt wurde, gründete auf einer überwiesenen Motion.
Der Entscheid fiel schon damals sehr knapp aus.
Freiburg
ist neben Solothurn der einzige Kanton, der den Exekutiven die Kompetenz gibt,
die Ortsplanung zu verabschieden.
«Man muss der Bevölkerung das Wort geben», betonte Grossrat Bruno Marmier in
der Debatte. Die Gegner argumentierten mit dem Risiko komplizierter und
längerer Verfahren.
 Mittwoch, 09.10.204 Mittwoch, 09.10.204
Freiburger Parlamente dürfen bei Ortsplanung nicht
mitreden
Freiburg ist neben Solothurn der einzige Kanton, der den
Exekutiven die Kompetenz gibt, die Ortsplanung zu verabschieden.
Das Freiburger
Kantonsparlament will dabei bleiben und den Parlamenten keine Mitsprache
gewährleisten.
Freiburger
Parlamente dürfen bei Ortsplanung nicht mitreden - Audio & Podcasts - SRF
2021


2021
 
Der Grosse Rat überträgt Gemeinden das letzte Wort bei der Raumplanung
Urs Haenni Redaktion
Veröffentlicht am: 09.10.2021
Zuletzt geändert am: 08.10.2021
Dank einer
Stimme Unterschied überträgt der Grosse Rat den
Gemeindebürgerinnen und -bürgern das letzte Wort bei
Raumplanungsdossiers. Der Staatsrat hatte die Bevölkerung nur
über die allgemeinen Ziele der kommunalen Raumplanung mitreden
lassen wollen.
Im Kanton
Freiburg hat der Staatsrat den kantonalen Richtplan ausgearbeitet und
ihn dem Bundesrat weitergeleitet, ohne dass das Parlament darüber
hätte abstimmen können. Ähnlich sind die
Verantwortlichkeiten auf Stufe der Freiburger Gemeinden: Die
Gemeinderäte sind für die Pläne und Vorschriften der
Ortsplanung zuständig, ohne dass ein Generalrat oder eine
Gemeindeversammlung dazu Stellung nehmen könnte.
So haben die Gemeindebürger zum Beispiel nichts zu einer
Sonderzone für eine Kiesgrube oder einen Windpark zu sagen.
Freiburger ist neben Solothurn der einzige Kanton, in dem die alleinige
Entscheidungskompetenz bei der Exekutive liegt.
Dies wird sich
nun ändern. Der Freiburger Grosse Rat hat am Mittwoch eine Motion
der Grossräte Bruno Marmier (Grüne, Villars-sur-Glâne)
und Sébastien Dorthe (FDP, Matran) gutgeheissen, die diese
Befugnis in Zukunft den Legislativen der Gemeinden überträgt.
Neben der Annahme von Ortsplanungen ist damit auch das Initiativ- und
Referendumsrecht verbunden.
Der Grosse Rat stimmte über drei Punkte dieser Motion einzeln ab.
Jener, bei dem es um die Zuständigkeit der Gemeindelegislative
geht, wurde mit 44 gegen 43 Stimmen hauchdünn angenommen. Für
diesen Entscheid ertönte im Parlament Applaus.
Regierung wollte Kompromiss
«Der Staatsrat
ist im Prinzip mit einem stärkeren Einbezug der Bürger
einverstanden», sagte Staatsrat Jean-François Steiert (SP)
während der Ratsdebatte. Raumplanung sei eine wichtige Sache, und
demokratische Rechte sollten da nicht beschnitten werden. «Der
Staatsrat will nicht am Status quo festhalten», sagte Steiert.
 
Datum: 08 10 2021
Mehr
Mitbestimmung bei der Ortsplanung Bis anhin waren es die
Gemeinderäte, die entschieden haben, wie die Raumplanung aussehen
soll.
Als einer von zwei Kantonen kannte Freiburg keine direkte Mitbestimmung
der Gemeindebürger. "Bürgerinnen und Bürger können
sich zum Teil zu weit weniger wichtigen Sachen aussprechen, aber nicht
zu einer solch wichtigen Angelegenheit, wie man seine Gemeinde
weiterentwickeln soll.
"Das ist eigentlich nicht normal in einer funktionierenden Demokratie",
sagt Baudirektor und Staatsratspräsident Jean Francois Steiert
(SP).
Dieser Meinung waren auch die Mehrheit der Grossräte im Parlament.
Mit 78 zu 9 Stimmen sprachen sie sich für eine Mitsprache der
Bevölkerung aus.
Mit nur einer Stimme Unterschied sprach sich das Parlament zudem
dafür aus, dass die Annahme von Plänen nun bei der
Legislative liegen soll - entweder bei der Gemeindeversammlung oder
beim Generalrat. Was sind die Grundsätze?
Laut Baudirektor Steiert sei die Herausforderung nun, das Gesetz genau
so umzusetzen, dass die Gemeinden mitbestimmen könne und die
technischen Hürden nicht zu gross seien. "Eine Ortsplanung kann
bis zu 100 Seiten umfassen, da wäre es zu kompliziert, alle
einzelnen Punkte an einer Gemeindeversammlung auszudiskutieren."
Zudem sei es auch nicht sinnvoll, wenn die Bevölkerung über
jedes Stück Land einzeln mitbestimmen könne, da die
Interessen des Einzelnen sonst zu stark überwiegen könnten.
Den guten Mix finden Die richtige Mischung sei entscheidend.
An vielen Orten in der Schweiz ist es üblich, dass die
Bevölkerung bei den grossen Orientierungen mitbestimmen kann. Weil
die einzelnen Interessen könnten vor allem in kleineren Gemeinden
zu Problemen führen und Nachbarschaftsstreitigkeiten können
so in die Raumplanung hineingezogen werden.
Der Staatsrat hat nun zwölf Monate Zeit eine entsprechende
Gesetzesänderung auszuarbeiten und dem Grossen Rat zu unterbreiten
2020
 
Die Botschaft von Bürgern und Bürgerinnen
zu Handen des gesamten Generalrates und Stimmen der Aussenquartiere
   2019
VoVD nimmt Stellung zu der 4ten Ortplanungsrevision
2019
VoVD nimmt Stellung zu der 4ten Ortplanungsrevision
 Industrie Zone Birch1
Industrie Zone Birch1
Quelle Bild: SRF 24.04.2013
  VoVD nimmt Stellung zu der Erschliessung des Birch1
VoVD nimmt Stellung zu der Erschliessung des Birch1
Einsprache  Stellungnahme Stellungnahme  Mögliche Auswirkungen
Mögliche Auswirkungen
wenn die Regeln eines (PBR) nicht eingehlten werden
  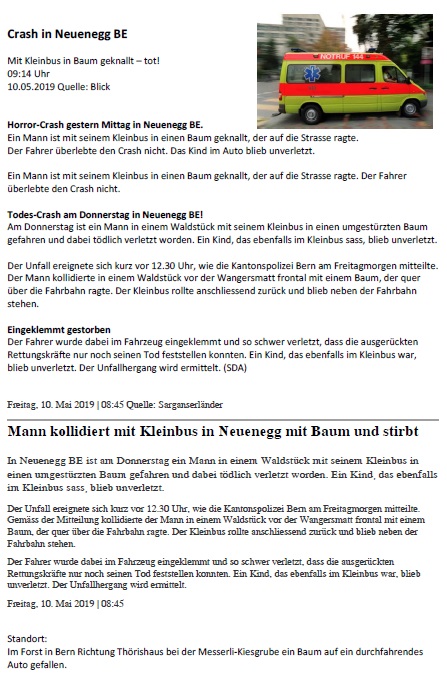 F Planungs- und Baureglement (PBR)
F Planungs- und Baureglement (PBR)

2015
Bei Ortsplänen behalten Gemeinderäte das letzte Wort
Ortspläne sind gemäss dem Grossen Rat bei den Gemeinderäten in guten Händen.Bild Corinne Aeberhard/a
Das Verabschieden von Ortsplänen
bleibt Sache der Gemeinderäte. Der Grosse Rat übergibt die
Kompetenz nicht dem Volk.
Es
bleibt so wie bisher: Ortspläne mit Richtplandossiers,
Zonennutzungsplänen und Reglemente können im Kanton Freiburg auch in
Zukunft nur durch Gemeinderäte verabschiedet werden. Der Grosse Rat hat
gestern eine Volksmotion mit 58 gegen 35 Stimmen verworfen, gemäss der
die Kompetenz auf Generalräte oder Gemeindeversammlungen übergegangen
wäre. Vor allem aus den Städten Freiburg und Bulle kam der Ruf, das
bestehende Gesetz entsprechend zu ändern. Mit der Bestätigung des
bisherigen Systems bleibt Freiburg einer von nur zwei Kantonen, wo das
Volk nicht über Ortspläne bestimmen kann.
Grosser Rat | 20.11.2015
Kein Abweichen vom Freiburger Kurs
Die Motion über die Verabschiedung von Ortsplänen hat ihre Wurzeln im Freiburger Generalrat.Bild Corinne Aeberhard/a
Die Genehmigung eines Ortsplans bleibt den
Gemeinderäten vorbehalten. Der Grosse Rat verweigerte
Generalräten oder Gemeindeversammlungen das Entscheidungsrecht.
Freiburg ist einer von nur zwei Kantonen mit dieser Praxis.
«Eine Demokratisierung der
Ortsplanung»–dies verlangte Grossrat Raoul Girard (SP,
Bulle) gestern von seinen Kollegen im Grossen Rat. Er hat als
Gemeinderat von Bulle erfahren, wie die Bevölkerung mittels einer
Petition forderte, bei der Ortsplanung des Greyerzer Hauptortes
mitzubestimmen. «Die Bevölkerung will sich ausdrücken
können. Sie kann es überall, nur bei der Ortsplanung
nicht», so Girard.
Dieser Meinung sind auch die Autoren einer Volksmotion
«Verabschiedung des Ortsplans durch den Generalrat respektive die
Gemeindeversammlung», welche gestern im Kantonsparlament
behandelt wurde. Hinter der Motion stehen zahlreiche Stadtfreiburger
Generalräte, so auch die grüne Grossrätin Christa
Mutter. Ortsplanung habe mit Grundstücken, Mobilität und
Umwelt zu tun, meinte sie, entsprechend betreffe die Abstimmung
über einen Ortsplan alle. Ihre Ratskollegin Andrea Burgener
Woeffray (SP, Freiburg) sagte, man müsse sich nur den Agglo-Rat
als Vorbild nehmen, da funktioniere das Mitbestimmen bei Planungsfragen
auch zur allgemeinen Befriedigung.
Rechts setzte sich durch
Dennoch beschloss der Grosse Rat, die Motion abzulehnen,
und die Verabschiedung von Ortsplanungen auch in Zukunft in der
Kompetenz der Gemeinderäte zu belassen. Er verwarf die Motion mit
58 gegen 35 Stimmen bei zwei Enthaltungen. Das linke Lager stimmte
für die Motion, das rechte mehrheitlich dagegen. Mit diesem
Entscheid bleibt Freiburg neben Solothurn der einzige Kanton mit dieser
Praxis (siehe Kasten).
Das Kantonsparlament folgte somit der Empfehlung des
Staatsrates. Die Freiburger Lösung entspreche dem Grundsatz der
Demokratie und dem Bundesrecht, eine neue Zuteilung der
Zuständigkeiten würde Verfahrensdauern verlängern, da
die Dossiers länger blockiert sein könnten, und die
Bürger hätten bei Kreditbegehren für
Baulanderschliessungen immer noch bedeutende Entscheidungskompetenz,
schrieb der Staatsrat in seiner Antwort.
Bau- und Raumplanungsdirektor Maurice Ropraz (FDP)
erwähnte, dass in der Ortsplanung die Bevölkerung durch
obligatorische Informationsabende immer auf dem Laufenden sei und sich
auch in die Raumplanungskommissionen einbringen könnte. Würde
die Legislative aber über Ortspläne abstimmen, so
müssten jeweils viele in den Ausstand treten, da sie als
Grundstückbesitzer direkt betroffen seien, so Ropraz.
Auch der freiburgische Gemeindeverband will nichts von
einer Änderung der bisherigen Praxis wissen, wie dessen
Präsidentin Nadia Savary (FDP, Vesin) sagte: «80 Prozent der
Gemeinden haben kein Problem mit der heutigen Regelung. Der Druck
für eine Änderung kommt hauptsächlich aus Bulle und
Freiburg. Aber eine solche hätte weitreichende Auswirkungen.»
«Es wäre
eine Katastrophe», meinte gar Christian Ducotterd (CVP, Grolley):
«Lehnt die Gemeindeversammlung einen Ortsplan ab, ist die ganze
Arbeit für nichts gewesen.» Ruedi Vonlanthen (FDP, Giffers)
fragte: «Wozu brauchen wir denn noch Gemeinderäte, wenn man
ihnen diese wichtige Aufgabe auch noch wegnimmt?» Für ihn
genügt die geltende Bau- und Raumplanungsgesetzgebung vollauf:
«Suchen wir nicht ein Problem, wo keines ist! Die
Gemeinderäte können über Ortspläne neutral
entscheiden, sie stehen über der Sache.»
Motion: Der dritte Versuch ist gescheitert
D ie am 29. Mai 2015 vom Freiburger Generalrat Christoph
Allenspach und 341 Mitunterzeichnern eingereichte Motion verlangte eine
Änderung des kantonalen Raumplanungs- und Baugesetzes. Der Antrag
betraf namentlich den Artikel, der besagt, dass der Gemeinderat
für die Verabschiedung des Ortsplans mit Richtplandossiers, dem
Zonennutzungsplan und den dazugehörigen Reglementen zuständig
ist. Gemäss der Motion sollten die Gemeinden die Möglichkeit
haben, diese Kompetenz dem Generalrat oder der Gemeindeversammlung zu
übertragen.
Ähnliche Vorstösse waren 2008 bei der Revision
des Raumplanungsgesetzes und 2013 bei einer ähnlichen Motion
erfolgt, beide lehnte der Grosse Rat aber ab. Das Bundesgericht hat vor
rund 15 Jahren bestätigt, dass die Freiburger Praxis mit dem
Bundesrecht vereinbar ist. Trotzdem sind es in der Schweiz nur zwei
Kantone, welche die Kompetenz zur Verabschiedung eines Ortsplans bei
der Gemeinde-Exekutive belassen: Freiburg und Solothurn. In Freiburg
gilt aber die Pflicht, dass ein Gemeinderat vor der Verabschiedung
eines Ortsplans einen Informationsabend für die Bevölkerung
durchführt. Dies machten die Gemeinden sehr gewissenhaft, betonte
Staatsrat Ropraz gestern. uh
Volk soll nicht über Ortsplan abstimmen
Der Staatsrat befürchtet,
eine neue Aufteilung der Zuständigkeiten für die Ortsplanung
könnte die Verfahrensdauer verlängern. Bild vm/a
Der Staatsrat ist dagegen, dass der
Ortsplanungs-Prozess demokratischer wird und die Gemeindeversammlung
oder der Generalrat die Pläne verabschieden. Er beantragt, eine
entsprechende Volksmotion abzulehnen. Motionär Christoph
Allenspach hofft nun auf den Grossen Rat.
Die Exekutive soll weiterhin das letzte Wort haben, wenn
es um Richtplandossiers, Zonennutzungspläne und deren Reglemente
geht. Dieser Auffassung ist der Freiburger Staatsrat. Eine Volksmotion,
die von einem überparteilichen Komitee aus Stadtfreiburger
Generalräten eingereicht wurde und 341 Mitunterzeichnende aus dem
ganzen Kanton zählt, findet bei der Kantonsregierung deshalb keine
Unterstützung. In der Motion fordert allen voran der Freiburger
SP-Generalrat Christoph Allenspach, dass in Zukunft nicht der
Gemeinderat, sondern der Generalrat und die Gemeindeversammlung das
Recht haben, die Ortspläne zu verabschieden. Dies würde die
Bevölkerung dazu bewegen, im Dossier Ortsplanung aktiver
mitzumachen, argumentieren die Motionäre. Daraus wiederum
könnten bereichernde Vorschläge für die künftige
Entwicklung der Gemeinde entstehen, finden sie.
Partizipation reicht aus
Der Staatsrat hingegen ist der Auffassung, dass die
Bevölkerung bereits angemessen an den Ortsplanungsverfahren
beteiligt ist. Sei es durch die Teilnahme an gesetzlich
vorgeschriebenen Informationsveranstaltungen, durch die
Möglichkeit, Bemerkungen und Vorschläge zum Richtplandossier
zu machen, oder durch das Recht, gegen die Nutzungspläne und die
Reglemente Einsprache zu erheben. Zudem werde der Gemeinderat bei der
Ausarbeitung des Ortsplans von einer Planungskommission
unterstützt, deren Mitglieder mehrheitlich von der
Gemeindeversammlung oder dem Generalrat bestimmt würden. Wie aus
der gestern veröffentlichten Antwort des Staatsrats hervorgeht,
befürchtet dieser, dass mit einer neuen Aufteilung der
Zuständigkeiten Projekte in den Gemeinden blockiert würden,
dies vor allem «vor dem neuen restriktiven Hintergrund, der vom
Bundesrecht vorgeschrieben wird».
Der Staatsrat erinnert zudem daran, dass das
Kantonsparlament eine ähnliche Motion im September 2013 mit 55 zu
31 Stimmen abgelehnt hatte und weist darauf hin, dass dieses Thema im
Grossen Rat bereits im Jahr 2008 bei der Totalrevision des
Raumplanungsgesetzes debattiert wurde. Damals wie bei der Motion habe
das Kantonsparlament entschieden, dass weiterhin ausschliesslich die
Exekutive für die Ortsplanung zuständig sein soll.
Parteiübergreifend
Motionär Christoph Allenspach geht davon aus, dass
die Abstimmung im Kantonsparlament dieses Mal anders ausfallen wird.
«Die Mitwirkung in der Ortsplanung ist kein Links-rechts-Thema
mehr, sondern wird von allen Parteien getragen», so der
SP-Generalrat. Der Freiburger Generalrat etwa unterstütze diese
Volksmotion zu 100 Prozent. Er zähle deshalb darauf, dass die
Abstimmung im Grossen Rat zu diesem Vorstoss diesmal anders ausfallen
werde als 2013. «Immer mehr Kreise wünschen sich mehr
Demokratie in der Ortsplanung», sagt Allenspach.
Der Kanton Freiburg ist zusammen mit dem Kanton
Solothurn der einzige, in dem die Gemeindeexekutive dafür
zuständig ist, den Ortsplan zu verabschieden.
Agglo: Der Staatsrat relativiert
D ie Motionäre der Volksmotion
«Verabschiedung des Ortsplans durch die Legislative»
argumentieren mit der Agglomeration Freiburg. Die Agglo habe diese
Praxis in ihren Statuten eingeführt und sie bei der Verabschiedung
des Richtplans erfolgreich angewandt. Der Agglorat, also die
Legislative, konnte darüber entscheiden. Dies soll die Volksmotion
auch für die Gemeinden erreichen. «Es ist eine
Ungleichbehandlung gegenüber den Gemeinden, die sich bewährt
hat», sagt Motionär Christoph Allenspach, Freiburger
SP-Generalrat und Agglorat. Der Staatsrat antwortet, er müsse
zugeben, dass diese Verteilung «scheinbar tatsächlich keine
grösseren Schwierigkeiten bereitet». Er weist aber darauf
hin, dass die Zuständigkeiten auf Agglo-Ebene auf die Richtplanung
beschränkt seien, weshalb die «Ungleichbehandlung»
relativiert werden müsse. ak
Autor: Karin Aebischer
Der Kanton Freiburg schränkt die Freiheiten der Landbesitzer ein
Der Kanton kontrolliert die Verwaltung der Bauzonen stärker. So will es das neue Raumplanungsgesetz.
Der Kanton kontrolliert die Verwaltung derBauzonenstärker. So will es das neue Raumplanungsgesetz.
Zersiedelung stoppen, Landschaft
schützen–Freiburg packt die Umsetzung des neuen
Raumplanungsgesetzes an: Künftig bezahlen Landbesitzer, deren Land
durch eine Einzonung an Wert gewinnt, eine Abgabe von 30 Prozent.
Erhält Land durch eine Nutzungsänderung mehr Wert,
beträgt die Abgabe 20 Prozent. Landbesitzer werden zudem kein
Bauland mehr horten können: Bebauen sie es innert zehn Jahren
nicht, kann die Gemeinde es kaufen. Gestern hat Baudirektor Maurice
Ropraz den entsprechenden Gesetzesvorentwurf präsentiert, bald
wird ihn der Grosse Rat behandeln. mir
Neues Raumplanungsgesetz wird konkret
Landbesitzer müssen ihr Bauland künftig bebauen, statt es zu horten. Bild Aldo Ellena/a
Durch das Bauzonenmoratorium bekommen
Gemeinden die Auswirkungen des neuen Raumplanungsgesetzes bereits zu
spüren. Nun ergreift auch der Kanton Freiburg Massnahmen. So
werden beispielsweise Landbesitzer ihr Bauland künftig nicht mehr
horten können.
«Das neue Raumplanungsgesetz bringt einen
Paradigmenwechsel»–diesen Satz hat Baudirektor Maurice
Ropraz (FDP) schon oft gesagt. Und auch gestern an einer
Pressekonferenz wiederholte er ihn und fügte an: «Auch nach
dem Bauzonenmoratorium wird die Raumplanung strenger, eine
Rückkehr zum alten System gibt es nicht.» Mit dem neuen
Raumplanungsgesetz, welches das Schweizer Stimmvolk im März 2013
angenommen hat (siehe Kasten), sind die Kantone gefordert. Der Bund
bewilligt Einzonungen von Bauland erst, wenn ein Kanton zeigen kann,
dass er erstens die bisher gehorteten Grundstücke genutzt hat,
zweitens vorhandene Häuser und Siedlungen saniert und drittens die
Bauzonen optimal nutzt, also verdichtet bebaut.
Kein Horten mehr
Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, hat
Baudirektor Maurice Ropraz gestern zwei wesentliche Veränderungen
im kantonalen Raumplanungs- und Baugesetz präsentiert. Mit den
ersten Änderungen müssen Landbesitzer, deren Land durch eine
Umnutzung oder eine Einzonung an Wert gewinnt, eine sogenannte
Mehrwertabgabe bezahlen. Mit der zweiten Änderung wird das Horten
von Bauland verunmöglicht: Land in der Bauzone muss innert 15
Jahren überbaut werden. Liegt in den ersten zehn Jahren kein
Bauprojekt vor, erhält die Gemeinde das Vorkaufsrecht.
«Gewisse Gemeinden konnten sich bisher nicht entwickeln, weil
Landbesitzer jahrelang auf ihrem Bauland sassen», sagte Ropraz.
Dies soll nun nicht mehr möglich sein.
Die Sätze für die Mehrwertabgabe belaufen sich
auf 20 Prozent für Umnutzungen und auf 30 Prozent für
Einzonungen. Das Geld fliesst in einen kantonalen Fonds. «Der
Kanton wird den Fonds verwalten, das Geld kommt aber den Gemeinden
zugute», sagte Ropraz. Ein Teil des Fonds soll nämlich in
den bestehenden Fonds für Bodenverbesserungen fliessen. Einen
weiteren Teil des Geldes sollen Gemeinden erhalten, die Landbesitzer
entschädigen müssen, weil deren Land durch eine Auszonung an
Wert verliert. «Nicht jede Auszonung bedeutet, dass der Besitzer
Anrecht auf eine Entschädigung hat», betonte Giancarla Papi,
Leiterin des Bau- und Raumplanungsamts.
Die Entschädigung sei beispielsweise gedacht, wenn
jemand sein Landstück bereits erschlossen habe, dies jedoch wieder
zu Landwirtschaftsland werde und nicht bebaut werden dürfe.
Schliesslich soll ein dritter Teil des Fonds in die Studien fliessen,
welche die Gemeinden durchführen, um das verdichtete Bauen zu
fördern.
«Der Fonds fördert die Solidarität unter
den Gemeinden», sagte Ropraz. In den kommenden Jahren werde es
Gemeinden geben, zum Beispiel in der Agglomeration Freiburg, die
verstärkt Bauland einzonen werden. Durch die Mehrwertabgabe
bekommen sie Geld, das den Fonds speist. Andere Gemeinden, die
über grosse Baulandreserven verfügen, werden auszonen und
Entschädigungen bezahlen müssen, sie erhalten Geld aus dem
Fonds.
Es sei schwierig zu berechnen, wie viel Geld in
den Fonds fliessen werde, sagte Patrick Ramuz, juristischer Berater
beim Bau- und Raumplanungsamt. Mit optimistischen Schätzungen gehe
der Kanton in den nächsten 15 Jahren von 74,3 Millionen Franken
aus, mit pessimistischen Schätzungen von 29,6 Millionen Franken.
«Vor allem solange das Bauzonenmoratorium gilt, wird wenig Geld
in den Fonds fliessen, da es kaum Einzonungen geben wird», sagte
Ropraz.
Gemeinden nicht autonom
In der Vernehmlassung zum Gesetzesvorentwurf hatte der
Gemeindeverband gemäss Ropraz angefragt, ob es möglich
wäre, den Fonds regional zu verwalten. Dies mache jedoch keinen
Sinn, weil der Staat mit einem kantonalen Fonds die Bauzonen besser
kontrollieren könne und es zudem zu viel Ressourcen bräuchte,
wenn es mehrere Fonds gebe.
Die Höhe der Abgabe habe kaum zu Bemerkungen
geführt, sagte Giancarla Papi. Ropraz hielt jedoch fest, dass
diese sicher für Diskussionen im Grossen Rat sorgen werden. Die
linken Parteien würden sich wohl für höhere Sätze
aussprechen, die bürgerlichen eher für tiefere. Die Vorgabe
des Bundes liege bei 20 Prozent. «So sind wir bereits relativ
tief», sagte Ropraz. Er wies darauf hin, dass durch die Abgabe
die Grundstückgewinnsteuer sinke. Erhöhe man also den Satz
für die Abgabe, würden dafür die Einnahmen bei der
Grundstückgewinnsteuer geringer ausfallen. Der Grosse Rat wird den
Gesetzesvorentwurf im Dezember oder im Februar behandeln.
Unter Druck
Sowohl Maurice Ropraz als auch Giancarla Papi hielten
fest, dass die Gemeinden bedauerten, dass sie mit dem neuen
Raumplanungsgesetz Autonomie verlören. «Gleichzeitig
kontrolliert der Bund die Kantone viel stärker», sagte
Ropraz. Er machte damit deutlich, dass der Kanton mit den Massnahmen
zwar einen gewissen Druck auf die Landbesitzer und die Gemeinden
ausübt, dass aber auch der Druck auf den Kanton wächst.
Spätestens 2019 muss der Bund den kantonalen Richtplan genehmigen,
ansonsten werden die Bauzonen eingefroren. Dann wäre auch der
Austausch wie beim jetzigen Moratorium–wer einzonen will, muss
die selbe Fläche auszonen–nicht mehr möglich.
«Wir sind beim Richtplan im Zeitplan», sagte Ropraz. Schon
nächsten Monat will er das kantonale Planungsprogramm
präsentieren, das der Grosse Rat 2016 validieren soll. 2017 soll
der Richtplan schliesslich in die Vernehmlassung, so dass der Staatsrat
ihn 2018 an den Bund weitergeben kann.
Zahlen und Fakten
Revision zum Schutz der Landschaft
Mit der Teilrevision des
Raumplanungsgesetzes sollen bestehende Siedlungen verdichtet und damit
die Zersiedelung gestoppt und die Landschaft geschützt werden. Der
Teilrevision hat die Schweizer Bevölkerung am 3.März 2013
zugestimmt, in Freiburg lag der Ja-Anteil bei knapp 63 Prozent. Am
1.Mai 2014 ist die Teilrevision in Kraft getreten. Für die
Umsetzung der eidgenössischen Vorgaben sind die Kantone
zuständig. Sie haben bis 2019 Zeit, einen entsprechenden
kantonalen Richtplan zu erlassen. Bis dahin gilt das
Bauzonenmoratorium: Einzonungen sind nur bei gleichwertigen Auszonungen
möglich. Mit dem bisherigen Raumplanungsgesetz hatten die
Gemeinden einen grossen Handlungsspielraum bei den Bauzonen, diese
werden sie verlieren. Sie müssen sich auch besser mit den
Nachbargemeinden absprechen.mir
Autor: Mireille Rotzetter
Der Kanton Freiburg verfügt nun über genügend grosse Fruchtfolgeflächen

Fruchtfolgeflächen sind potenziell ackerfähige Flächen.Bild Aldo Ellena/a
Neu hat Freiburg eine Reserve von 171 Hektaren Fruchtfolgeflächen. Einzonungen sind wieder möglich.
Fruchtfolgeflächen beschäftigen Landwirte,
Gemeinden und Raumplaner. Es sind landwirtschaftlich nutzbare
Flächen, die unter Schutz gestellt sind, damit in der Schweiz auch
in Krisenzeiten und in Zeiten, in denen nichts importiert werden kann,
genügend Nahrung vorhanden ist. Jeder Kanton hat einen
Mindestumfang an Fruchtfolgeflächen, den er erfüllen muss.
Bisher hatte der Kanton Freiburg sein Soll von
35 800 Hektaren nicht erfüllt. Gestern berichteten
Landwirtschaftsdirektorin Marie Garnier (Grüne) und Baudirektor
Maurice Ropraz (FDP) an einer Pressekonferenz stolz, dass sich dies nun
geändert habe. Mit 35 971 Hektaren Fruchtfolgeflächen
verfügt der Kanton neu über eine Reserve von 171 Hektaren.
«Das ist eine grosse Erleichterung», sagte Maurice Ropraz.
Denn da der Kanton das Soll nicht erfüllt hatte, verhängte
der Bund Freiburg ein unbedingtes Verbot für die Einzonung von
Fruchtfolgeflächen. Dies blockierte verschiedene Bauprojekte und
auch Ortsplanungsrevisionen. Neu sind Einzonungen unter strengen
Bedingungen wieder möglich (siehe Kasten).
Die 35 971 Hektaren Fruchtfolgeflächen
entsprechen knapp der Hälfte der gesamten landwirtschaftlichen
Nutzfläche des Kantons, die rund 78 000 Hektaren beträgt.
Neue Berechnungen
An der gestrigen Pressekonferenz wurde deutlich: Der
Kanton Freiburg verfügt nicht im eigentlichen Sinn über mehr
bestes Kulturland als noch vor ein paar Jahren, die Flächen wurden
lediglich neu und genauer bemessen. «Wir haben gemerkt, dass wir
die Fruchfolgeflächen nach strikteren Kriterien berechnet hatten
als andere Kantone», sagte Ropraz.
Damit Kulturland als Fruchtfolgefläche gelten kann,
muss es gewisse Kriterien erfüllen. So muss die Fläche
mindestens ein Hektar gross sein, eine geringere Hangneigung als 18
Prozent aufweisen, in einer geeigneten Klimazone sein, gewisse
Richtwerte bezüglich Schadstoffe und Dichte erfüllen sowie
mindestens 50 Zentimeter tief sein. Vor allem letzteres Kriterium war
nicht ganz einfach zu beweisen, wie David Aeschlimann,
wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Landwirtschaftsdirektion,
ausführte. Für die anderen Kriterien konnten sich die
Mitarbeiter auf Karten stützen, die Tiefe musste jedoch zum Teil
vor Ort bemessen werden.
Um den Mindestumfang an Fruchtfolgeflächen zu
erreichen, griffen die Mitarbeiter auch zu Kniffen: Gewisse Wiesen oder
Äcker galten bisher nicht als Fruchtfolgeflächen, da ein Teil
der Fläche die Kriterien nicht erfüllte, beispielsweise stark
geneigt war. Solche Flächen teilte der Kanton nun auf, sodass der
«gute» Teil als Fruchtfolgefläche gelten kann.
Ebenfalls arbeitete der Kanton genauer und bemass Wege
oder teilweise landwirtschaftlich bebaute Flächen exakter. So
verzichtete der Bund darauf, einen Abzugskoeffizienten anzuwenden:
Zuvor hatte er zwei Prozent der angegebenen Fruchtfolgefläche
abgezogen, um Ungenauigkeiten zu bereinigen.
Nach verschiedensten Anpassungen und etlichen Kontakten
mit dem Bundesamt für Raumentwicklung ARE anerkannte dies nun,
dass der Kanton das Soll erfülle. «Alle gewinnen»,
sagte Garnier. «Auch die Landwirtschaft und die Umwelt, da nun
mehr Grünflächen geschützt sind.»
Probleme auch andernorts
Fruchtfolgeflächen sorgen in anderen Kantonen
für Probleme. Etliche fordern deshalb, dass der Bund seinen
«Sachplan Fruchtfolgeflächen» überarbeitet und
die Kriterien ändert. «Darauf konnten wir nicht warten. Wir
wären zu lange blockiert gewesen», sagte Maurice Ropraz.
Einzonungen: Für Projekte von kantonaler Bedeutung möglich
D a Freiburg nicht genügend
Fruchtfolgeflächen besass, durften diese keinesfalls eingezont
werden. Gewisse Bauprojekte waren blockiert. Baudirektor Maurice Ropraz
nannte gestern als Beispiele den Ausbau der Schule in Granges-Paccot
oder die Vergrösserungen von Abwasserreinigungsanlagen. Da der
Kanton nun über eine Reserve an Fruchtfolgeflächen
verfügt, werden Einzonungen wieder möglich: für Projekte
von kantonaler Bedeutung und wenn verdichtet gebaut wird. Firmen mit
vielen Arbeitsplätzen könnten profitieren, oder Strassen- und
Eisenbauprojekte könnten möglich sein. Ropraz betonte aber,
dass er die Reserve nicht zu schnell aufbrauchen wolle. Und weiterhin
gelte das Moratorium im Rahmen des neuen Raumplanungsgesetzes: Wird
Bauland eingezont, muss dieselbe Fläche anderswo ausgezont werden.
mir
Autor: Mireille Rotzetter
Raumplanungsgesetz | 07.05.2015
«Überstürzt und schlecht gemacht»

Jedem sein Einfamilienhaus:
Das neue Raumplanungsgesetz setzt dieser Vorstellung ein Ende,
Verdichtung ist Trumpf. Bild Aldo Ellena/a
Der Freiburger Staatsrat übt scharfe
Kritik an der zweiten Etappe der Revision des Raumplanungsgesetzes des
Bundes und lehnt diese klar ab. Der Entwurf trete die
Zuständigkeit der Kantone mit Füssen und komme viel zu
früh.
«Wir haben momentan weder die Zeit noch die
Ressourcen, diese zweite Revision des Raumplanungsgesetzes
anzugehen.» Die Botschaft von Staatsrat Maurice Ropraz an der
gestrigen Pressekonferenz war klar: Keine erneute Änderung der
Spielregeln, bevor nicht die erste Etappe der Revision des
Raumplanungsgesetzes (RPG) über die Bühne ist. Denn mit
dieser habe das Freiburger Bau- und Raumplanungsamt in den
nächsten Jahren bereits alle Hände voll zu tun. Der Kanton
Freiburg muss ein Gesetz über den Mehrwert ausarbeiten und seinen
Richtplan erneuern. «Wir arbeiten intensiv daran», so
Ropraz. Deshalb komme die zweite Etappe der Revision des
Bundesgesetzes, die noch bis zum 15. Mai in der Vernehmlassung
ist, viel zu früh. Und, betonte Ropraz, gebe es schon wieder eine
Änderung der Vorgaben, würde dies in den Gemeinden erneut
Unverständnis und Frustration auslösen.
«Keine Strategie»
Der Zeitpunkt ist nicht der einzige Kritikpunkt der
Freiburger Regierung an der zweiten Revisionsetappe des
Raumplanungsgesetzes. Dem Entwurf des Bundes fehle es an Strategie,
betonte der Bau- und Raumplanungsdirektor. Die wirtschaftliche
Entwicklung hänge stark von den Rahmenbedingungen ab, die von der
Raumplanung vorgegeben würden. Dieser Entwurf der zweiten Etappe
schaffe jedoch keine Verbindung zwischen sparsamer Bodennutzung und
weiterer wirtschaftlicher Entwicklung, so die Kritik aus Freiburg am
Bund.
«Überstürzt, schlecht gemacht,
unpassend, ja sogar unangebracht.» Staatsrat Ropraz und auch
Giancarla Papi, Vorsteherin des Bau- und Raumplanungsamts, liessen
gestern kein gutes Haar an der erneuten Revision des
Raumplanungsgesetzes. Sie gehe weder auf die Anliegen und
Vorschläge der Kantone ein, noch gewähre sie diesen genug
Spielraum und Kompetenzen. «Die Zuständigkeit der Kantone
wird mit Füssen getreten», so Ropraz. Der Entwurf gehe zu
weit. «Zu viele Details», betonte er. Andere wichtige
Themen hingegen lasse der Entwurf aus oder verkompliziere die
Bestimmungen, erklärte Giancarla Papi und nannte als Beispiel
Bauten ausserhalb der Bauzone und die Frage, ob und wie diese genutzt
werden könnten.
Der Staatsrat lehnt auch die vom Bund beantragten
Bestimmungen zum Schutz der Fruchtfolgeflächen ab. Wie die
übrigen Kantone verlangt Freiburg seit mehreren Monaten eine
Revision des Sachplans des Bundes aus dem Jahr 1992, damit die
Zuteilungsquoten neu beurteilt und die Erhebungsmethoden
vereinheitlicht werden können. Denn der Schutz dieser Flächen
soll verstärkt werden. Dies bringe aber nichts, wenn vorher nicht
erst eine Grundsatzdebatte über die Ziele und die angestrebte
Gesamtstrategie stattgefunden habe, erklärte Giancarla Papi. All
diese Punkte hat der Staatsrat in seiner schriftlichen Stellungnahme
zur Vernehmlassung aufgelistet.
Er hoffe, so Maurice Ropraz, dass der Bund den Kantonen
die nötige Zeit gewähre, um erst die erste Revisionsetappe
umzusetzen. Denn sonst laufe das System Gefahr, vollkommen blockiert zu
sein.
Nicht die einzigen Kritiker
Freiburg steht mit seiner Kritik nicht alleine da: Die
Baudirektorenkonferenz der Kantone hatte am Montag an einer
Medienkonferenz zusammen mit dem Gewerbeverband, dem Gemeindeverband,
der Bauwirtschaft und dem Hauseigentümerverband die laufende
zweite Etappe der RPG-Revision scharf kritisiert (FN vom Dienstag). Auf
den Vorschlag von Bundesrätin Doris Leuthard hin haben sich das
Umweltdepartement des Bundes und die Baudirektorenkonferenz inzwischen
darauf geeinigt, dass die Revision vorerst nicht weiter vorangetrieben
wird und die gesetzgeberischen Arbeiten bis Ende Jahr eingestellt
werden. Diese Denkpause reicht dem Kanton Freiburg aber nicht aus.
«Wir brauchen mehrere Jahre Zeit, bis wir die erste Etappe
umgesetzt haben», sagt Ropraz.
Revision
Gegen Zersiedelung der Landschaft
In der Abstimmung vom 3.März 2013 genehmigte das
Schweizer Stimmvolk eine Änderung des Bundesgesetzes über die
Raumplanung; diese ist am 1.Mai 2014 in Kraft getreten. Ziel der
Änderung ist es, mit der Verdichtung bestehender Siedlungen die
Landschaft zu schützen. Für die Umsetzung der Vorgaben sind
die Kantone zuständig. Sie müssen in fünf Jahren einen
Richtplan erlassen. Bis der Bundesrat diesen genehmigt hat, dürfen
Einzonungen nur bei gleichwertigen Auszonungen vorgenommen werden.ak
Bodenpolitik | 31.01.2015
Raumplanung bleibt Knacknuss

Die Bibera im Grossen Moos soll mehr Platz erhalten, dafür gehen aber Fruchtfolgeflächen verloren. Bild Aldo Ellena/a
Mit dem neuen Raumplanungsgesetz des Bundes
sind die Weichen der Bodenpolitik neu gestellt. Gemeinden bangen um
Bauparzellen, Landwirte um genügend Fruchtfolgeflächen. Dies
zeigte sich auch am Infoabend in Murten.
Das Raumplanungsamt hat auf seiner Infotour in den
Bezirken am Donnerstagabend in Murten Halt gemacht. Staatsrat Maurice
Ropraz (FDP) und Giancarla Papi, Vorsteherin des Bau- und
Raumplanungsamtes, stellten sich den Fragen der Seebezirkler. Die Aula
der Orientierungsschule Region Murten war mit über 150
Gemeindevertretern und weiteren Interessierten gut gefüllt. Sie
alle wollten mehr wissen über die Umsetzung des neuen
Raumplanungsgesetzes des Bundes.
«Das neue Raumplanungsgesetz geht einher mit einem
Paradigmenwechsel», sagte Ropraz. «Die Autonomie der
Kantone und der Gemeinden ist geringer, die Kontrolle des Bundes
grösser.» Die Fruchtfolgeflächen würden besser
geschützt und Siedlungsflächen verdichtet. Der Kanton sei nun
gefordert: Der Vorentwurf zur neuen Regelung der Mehrwertabgabe sei in
der Vernehmlassung, der kantonale Richtplan in Revision. Bis dieser
2019 in Kraft ist, gilt ein Moratorium, während dem Land nur bei
gleichwertiger Auszonung eingezont werden darf.
Über die Gemeinde hinweg
«Muss ich also zum Beispiel in Jaun betteln gehen,
wenn ich 25 000 Quadratmeter Bauland benötige?», fragte
Heinz Etter, Gemeindepräsident von Ried. «Es ist
möglich, zwischen verschiedenen Gemeinden zu kompensieren»,
antwortete Ropraz. Ob dies in Eigenregie der Gemeinden geschehen
dürfe, sei noch offen. Diese Frage werde zurzeit im Grossen Rat
diskutiert.
Neben dem Richtplan ist die Neuregelung der
Mehrwertabgabe Teil des Bundesgesetzes zur Raumplanung. Der Vorentwurf
sieht zwei Varianten vor: einen Einheitssatz von 20 Prozent und einen
differenzierten Satz von 30 Prozent für neue Einzonungen und 20
Prozent für Nutzungsänderungen. Das Geld fliesst in den
Mehrwertabgabe-Fonds des Kantons (Beispiel siehe Kasten).
Eddy Wernli, Syndic von Gurwolf, hinterfragte den Satz
der Abgabe: Weil die Grundstückgewinnsteuer nach Abzug der Abgabe
geringer ausfalle, fliesse so künftig weniger Geld in die
Gemeindekasse. «Das neue Gesetz schreibt mindestens 20 Prozent
vor», erklärte Ropraz. «Je höher die
Mehrwertabschöpfung, desto tiefer fällt der Betrag der
Grundstückgewinnsteuer aus – und diese beiden Abgaben gehen
nicht in dieselbe Kasse», bestätigt Daniel Lehmann,
Oberamtmann des Seebezirks.
Lehmann kritisierte zudem die Abgabe auf
Nutzungsänderungen von Bauland: Es bestehe kein Anreiz zu
Verdichtung, wenn auch Nutzungsänderungen der Mehrwertabgabe
unterstünden. Denn eine Änderung der Ausnützungsziffer
bedeute faktisch eine Nutzungsänderung, «zum Beispiel von
mittlerer Dichte zu hoher Dichte». Der Eigentümer von Land,
dessen Index geändert werde, müsse also eine Mehrwertabgabe
leisten. «Der Teufel liegt im Detail», sagte Lehmann.
Sorge um Fruchtfolgefläche
Thomas Wyssa, Ammann von Galmiz, fragte Ropraz, wie der
Kanton die vorgeschriebenen, aber fehlenden Fruchtfolgeflächen zu
regeln gedenke. Denn vorher werde das Moratorium nicht aufgehoben.
«Laut Bund fehlen uns 236 Hektaren», antwortete Ropraz.
Doch habe der Bund nicht alle Fruchtfolgeflächen eingerechnet.
«Deshalb braucht es eine Neuberechnung», sagte Ropraz.
«Für den Gewässerschutz im Grossen Moos müssen wir
noch zusätzliche Fruchtfolgeflächen hergeben», gab
Wyssa zu bedenken. Dabei handle es sich um sehr viele Hektaren. Auf der
einen Seite brauche die vom Bund vorgeschriebene Revitalisierung der
Bibera Land, auf der anderen dürfe der Kanton die
Fruchtfolgeflächen aber nicht verringern – eine
Zwickmühle. «Der Kanton sollte dem Bund sagen, dass das so
nicht geht», sagte Lehmann.
Einzonung: Wenn das Land massiv an Wert gewinnt
M oritz Bernal, Jurist beim Bau- und Raumplanungsamt,
machte am Infoabend in Murten ein Beispiel: Werden 10 000 Quadratmeter
Landwirtschaftsland zu Bauland umgezont und der Preis steigt von 10 auf
190 Franken, beträgt der Mehrwert 1,8 Millionen Franken. Bei 20
Prozent Mehrwertabgabe müsste der Eigentümer 360 000 Franken
abgeben. Bei 30 Prozent wären es 540 000 Franken. 20 Prozent als
Minimum hat der Bund jedoch vorgeschrieben, der Kanton hat nur
Spielraum nach oben. Die Verwendung des Mehrwertabgabe-Fonds ist noch
nicht geregelt. In allen Varianten des Vorentwurfs sollen damit
insbesondere Entschädigungen bei Auszonungen und die
Bodenverbesserungskörperschaften finanziert werden. emu
Autor: Etelka Müller
Die neue Raumplanung verunsichert

Die Unternehmen der Baubranche
befürchten, wegen des fünfjährigen Moratoriums
Arbeitsplätze abbauen zu müssen. Bild Vincent Murith/a
Landbesitzer und Gemeinden bangen um ihre
Bauparzellen, Bauunternehmen um ihre Arbeitsplätze: Das revidierte
Raumplanungsgesetz bringt einen grossen Wechsel. Am Mittwoch startete
der Kanton in Düdingen seine Infotour.
Rund 200 Interessierte, darunter viele
Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, Grossräte,
Architekten, Bauunternehmer und Landwirte wollten am Mittwoch mehr
darüber erfahren, wie sich die Umsetzung des revidierten
Bundesgesetzes über die Raumplanung auf den Kanton Freiburg
auswirkt. Am Informationsabend im Podium in Düdingen stellten sich
Staatsrat Maurice Ropraz (FDP) und Giancarla Papi, Vorsteherin des Bau-
und Raumplanungsamtes, ihren Fragen. Es war der erste von sieben
Anlässen, die Staatsrat Ropraz und seine Direktion bis Anfang
Februar durch alle Bezirke führt. Sie stellen das Projekt
«Raum 2030» vor, das die Instrumente enthält, um das
revidierte Raumplanungsgesetz im Kanton Freiburg umsetzen zu
können (siehe Kasten).
Zustimmung war gross
Der Sensler Oberamtmann Nicolas Bürgisser (FDP)
rief in seiner Begrüssung in Erinnerung, dass am 3. März
2013, als das Schweizer Volk der Änderung des Bundesgesetzes
über die Raumplanung zustimmte, 17 der 19 Sensler Gemeinden mit
über 70 Prozent Ja-Stimmen-Anteil die Revision unterstützt
hatten. Er sei sich aber nicht sicher, ob die Schweizerinnen und
Schweizer genau verstanden hätten, über was sie abstimmten.
«Die Revision wird für den Sensebezirk und den Kanton
einschneidende Konsequenzen haben», sagte er. Es gelte nun, das
Beste aus der Situation zu machen und sich mit den
Konsequenzen–«die noch sehr neblig
sind»–auseinanderzusetzen, so Nicolas Bürgisser.
Dass für die Gemeinden die Situation alles andere
als klar und einfach ist, zeigte sich in den vielen Fragen aus dem
Publikum. Der Alterswiler Ammann Hubert Schibli (CVP) umschrieb die
schwierige Lage seiner Gemeinde, die zig andere Gemeinden erfolglos
für eine Kompensation ihrer Fruchtfolgeflächen angefragt
hatte. «Das ist eine Suche nach der Nadel im Heuhaufen»,
sagte er. Gegen die Revision der Ortsplanung von Alterswil war
Beschwerde eingegangen, weil auf den landwirtschaftlich wertvollen
Böden, den sogenannten Fruchtfolgeflächen, Bauland eingezont
werden soll. «Es braucht noch einige Wochen, wir sind
dran», sagte Ropraz zur Behandlung der Alterswiler
Ortsplanungsrevision.
Eingezont und erschlossen
Ratlos zeigte sich auch Architekt Christoph Binz aus
St. Antoni. Er könne nicht nachvollziehen, weshalb eine
eingezonte und erschlossene Parzelle nicht bebaut werden dürfe.
«Wie kann man überhaupt sagen, dass diese eventuell wieder
ausgezont werden könnte?», fragte er Baudirektor Ropraz.
Auch Ständerat Urs Schwaller (CVP) meldete sich in dieser Sache zu
Wort. «Es kann doch nicht sein, dass genehmigte und erschlossene
Parzellen nicht bebaut werden dürfen. Das schafft
Rechtsunsicherheit», so Schwaller. Der Kanton sei deshalb
gefordert, Lösungen zu finden.
Er habe grosses Verständnis, antwortete Maurice
Ropraz nicht zum ersten Mal an diesem Abend auf die Äusserungen
aus dem Publikum. Der Kanton Freiburg habe jedoch viele
überdimensionierte Bauzonen und der Bund habe bereits einige
seiner Entscheide kritisiert, weshalb nun mehrere Dossiers blockiert
seien. «Wir müssen erst unsere Hausaufgaben machen»,
so Ropraz. Diese Aussage rief bei einem Bürger aus Schmitten
Verunsicherung hervor. «Ist man denn jetzt bei jeder eingezonten
Bauparzelle nicht mehr sicher, ob sie bebaut werden darf?», frage
er. «Ist die Bauzone in Kraft, ist das kein Problem», sagte
Giancarla Papi. Befinde sich die Ortsplanung jedoch in Revision und sei
nicht genehmigt, sei es unsicher.
Angst um Arbeitsplätze
Urs Schwaller rief Ropraz und Papi dazu auf, alles
dafür zu tun, um die Moratoriumsfrist von fünf Jahren zu
verkürzen und schneller am neuen Richtplan zu arbeiten. Aus Ropraz
Antwort war nicht viel Hoffnung herauszulesen, dass dies möglich
sein wird.
CVP-Grossrat Thomas Rauber aus Tafers,
Präsident des Gewerbeverbandes Sense, sorgt sich um die
Konsequenzen für die Unternehmen. 35 Prozent der
Arbeitsplätze im Sensebezirk seien in der Bauwirtschaft
angesiedelt. Er befürchtet, dass diese Firmen wegen des
Bauzonen-Moratoriums in den nächsten Jahren Arbeitsplätze
abbauen müssen. Rauber plädierte für eine
überregionale Zusammenarbeit und für flankierende Massnahmen
für die Unternehmen, um die Konsequenzen abzufedern. «Sind
solche geplant?», fragte er den Staatsrat. «Wir werden
alles tun, um die Unternehmen zu unterstützen, aber wir
müssen erst das Menü verdauen», sagte Ropraz. Die
Situation der Bauunternehmen sei auch für den Staatsrat eine
grosse Sorge, erklärte er. «Aber wir haben keine Wahl,
sondern ein grosses Interesse daran, das neue Gesetz umzusetzen, damit
das Moratorium auch aufgehoben wird.»
Infoabende im Saane- und Seebezirk: Do.,22. Januar, 19 Uhr, in der Ingenieurschule, Freiburg. Do.,29.Januar, 19 Uhr, in der OS Prehl, Murten.
Gesetzesrevision: Verdichtung und Schutz des Landes
M it dem revidierten Bundesgesetz über die
Raumplanung sollen bestehende Siedlungen verdichtet und so die
Landschaft geschützt werden. Die Kantone sind für die
Umsetzung der eidgenössischen Vorgaben zuständig. Im Kanton
Freiburg sind erste Massnahmen dazu bis März 2015 in der
Vernehmlassung. Dazu gehören die Mehrwertabgabe sowie Instrumente,
um die Hortung von Bauland zu verhindern (die FN berichteten). Der
zweite Teil ist die Totalrevision des kantonalen Richtplans. Das
Inkrafttreten des neuen Richtplans ist 2019 vorgesehen. Erst nach
diesen Anpassungen wird das Moratorium für die Ausscheidung von
Bauzonen aufgehoben. Dieses sieht vor, dass Einzonungen nur bei
gleichwertigen Auszonungen vorgenommen werden dürfen. ak
Autor: Karin Aebischer
Raumplanung | 05.12.2014 - 17:05
Kompensationspflicht für verbautes Ackerland
Die Bevölkerung wächst, immer
mehr Kulturland wird zugebaut, für Strassen, Schienen und
Leitungen fehlt der Platz. Dieser Entwicklung will der Bundesrat mit
einer weiteren Revision des Raumplanungsrechts Einhalt gebieten.
Geplant werden soll künftig in grösseren Räumen und mit
weiterem Blick in die Zukunft.
Die Vorlage, die der Bundesrat am Freitag in die
Vernehmlassung geschickt hat, stellt die heute geltende Ordnung nicht
auf den Kopf: Der Bund erlässt die Grundsatzgesetzgebung, die
Kantone regeln die Grundsätze der Planung in Richtplänen, die
Gemeinden machen die für Grundeigentümer verbindlichen
Vorschriften.
Das Anliegen, mit immer knapperen Ressourcen sinnvoll
und in zusammenhängenden Wirtschafts- und Siedlungsräumen zu
planen, macht aber doch eine Verschiebung von Zuständigkeiten hin
zum Bund nötig.
Gemeinsame Planung
So sieht der Entwurf vor, dass Bund, Kantone und
Gemeinden künftig gemeinsam eine Strategie für die
räumliche Entwicklung der Schweiz erarbeiten. Die Kantone sollen
im Rahmen der Richtplanung prüfen, ob sogenannte funktionale
Räume festzulegen sind - Gebiete, die wirtschaftlich,
gesellschaftlich oder ökologisch eng miteinander verflochten sind.
Ist dies der Fall, müssen die beteiligten Kantone
und Gemeinden die Raumentwicklung gemeinsam planen. Betrifft ein
funktionaler Raum das Gebiet mehrerer Kantone und liegt nicht innerhalb
von fünf Jahren eine gemeinsame Planung vor, soll der Bund die
Planung anstelle der Kantone vornehmen können. Einer
"Schönwetter-Regulierung" erteilt er in den Erläuterungen zur
Vorlage eine klare Absage.
Höher werden sollen auch die Anforderungen an die
Richtpläne. Darin müssten die Kantone nicht nur detailliert
Auskunft geben über die Siedlungsplanung, sondern auch über
Verkehr, Landwirtschaft, Natur, Landschaft und Naturgefahren, Energie,
Versorgung und Entsorgung sowie über Planungen, die den Untergrund
betreffen.
Weitere Zuständigkeiten sollen dem Bund zukommen,
wenn es um die Freihaltung von Flächen für Infrastrukturen im
nationalen Interesse geht, etwa für Hochspannungsleitungen,
Autobahnen oder Flughäfen. Um den dafür nötigen Platz
freizuhalten, soll der Bund Gebiete beispielsweise mit Einzonungs- oder
Erschliessungsverboten sichern können.
Kulturland sichern
Ein weiteres wichtiges Anliegen der Revision ist die
Versorgungssicherheit. Der Entwurf sieht dazu einen weit gehenden
Schutz von Fruchtfolgeflächen, das heisst ackerfähigem
Kulturland, vor. Diese wären in ihrem Bestand grundsätzlich
geschützt und dürften nur unter eingeschränkten
Bedingungen eingezont werden.
Zentrales Element des Kulturlandschutzes ist die
Kompensationspflicht für Fruchtfolgeflächen. Nur wenn es um
ein Bauvorhaben von übergeordnetem öffentlichem Interesse
oder um zonenkonforme Bauten für die Landwirtschaft geht, soll auf
Ersatz des Landwirtschaftslandes verzichtet werden können.
Zu den Konsequenzen, die sich ergeben, wenn ein Kanton
den vorgeschriebenen Mindestumfang an Fruchtfolgeflächen
unterschreitet, legt der Bundesrat zwei Varianten vor. Die strengere
Variante sieht vor, dass der Kanton keine Fruchtfolgeflächen mehr
einzonen darf.
Auch die Fläche, die für Bauten von
übergeordnetem Interesse oder für landwirtschaftliche Bauten
in Anspruch genommen wird, müsste kompensiert werden. Die weniger
strenge Variante sieht vor, dass der Bundesrat die Gesamtfläche
verkleinern kann, wenn es um solche Bauten geht.
Schliesslich soll mit der Revision des
Raumplanungsgesetzes das Bauen ausserhalb von Bauzonen neu geregelt
werden. Die vielen, zum Teil eher punktuellen Revisionen in den
vergangenen Jahren hätten zu einem komplexen und
unübersichtlichen Regelwerk geführt, schreibt der Bundesrat.
Dies erschwere einen einheitlichen und konsequenten Vollzug. Die
Bestimmungen sollen darum neu gegliedert werden. Grundlegende
materielle Änderungen sind aber nicht vorgesehen.
Im Entwurf sind zudem programmatische Neuerungen
enthalten, die zu reden geben könnten. So soll die
Siedlungsplanung neu auch die Bedürfnisse der Wirtschaft
berücksichtigen. Ausdrücklich vorgesehen sind weiter
Massnahmen, um für Haushalte mit geringem Einkommen ausreichend
Wohnraum zur Verfügung zu stellen.
Viele Anliegen bedient
Der Bundesrat greift mit der Vorlage Herausforderungen
vor, die sich aus der Energiestrategie 2050 ergeben werden, etwa mit
der Sicherung von Räumen für Infrastrukturen von nationalem
Interesse.
Zudem nimmt er die Anliegen verschiedener Initiativen
auf. Auf Ernährungssicherheit und Erhalt von Kulturland zielen die
Ernährungssicherheits-Initiative des Bauernverbands und die
Initiative "Für Ernährungssicherheit" von Uniterre ab. In
Bern ist eine Kulturland-Initiative hängig, das Zürcher
Stimmvolk hat eine solche schon angenommen.
Morgen Samstag wollen die Jungen Grünen eine
weitere nationale Initiative lancieren. Ziel ist es, Bauzonen
einzuschränken, Kulturland zu schützen und nachhaltiges,
verdichtetes Bauen zu fördern. Und schliesslich erfüllt der
Bundesrat auch sein eigenes Versprechen, die Folgen des
Bevölkerungswachstums unabhängig von der Beschränkung
der Zuwanderung abzufedern. Die Vernehmlassung dauert bis zum 15. Mai
2015.
SDA
Mehrere Kriterien für Fruchtfolgeflächen

Im Bericht über die Fruchtfolgeflächen auf
Seite 7 der gestrigen Ausgabe der Freiburger Nachrichten steht, dass
man bei der Aktualisierung des Fruchtfolgeflächen-Inventars (FFF)
aufgrund der Bundeskriterien bei den Hanglagen bis zu einer Neigung von
maximal 18 Prozent gehen könnte. Bisher wurden nur Flächen
mit einer Hangneigung von bis zu 15 Prozent berücksichtigt.
Staatsrätin Marie Garnier legt Wert auf die Präzisierung,
wonach bei der neuen Erhebung mehrere Kriterien festgelegt werden: So
wird ein Areal den FFF nur zugeteilt, wenn dieses ganz unter 800 Meter
Höhe liegt, mehr als 80 Prozent Ackerfläche aufweist und der
Anteil Hangfläche weniger als 10 Prozent ausmacht. ju
Freiburger Landwirte | 27.11.2014
Den Bauern weht der Wind kalt ins Gesicht

Die Freiburger Bauern befürchten, mit den Reformen in der Agrarpolitik den Kürzeren zu ziehen. Bild cr/a
Der kantonale Bauernverband (FBV)
fürchtet um das Einkommen der Freiburger Landwirte. Verschiedene
Reformen, von denen einige das Leben und die Arbeit vereinfachen
sollten, haben laut dem FBV bisher noch nicht den erwünschten
Nutzen gebracht. Und die Zahl der Betriebe sinkt.
Die Bauern schreiben das Jahr eins der Agrarpolitik
2014–2017 des Bundes. Eines der Kernelemente, der Ersatz der
Direktzahlungen durch neue Förderinstrumente, ging «in
vielen Bereichen nicht nach unserem Gusto» über die
Bühne, hielt gestern der Präsident des Freiburgischen
Bauernverbandes (FBV) Fritz Glauser anlässlich der
Jahres-Pressekonferenz fest. Der Bund habe den Systemwechsel schlecht
vorbereitet, so Glauser. Das kantonale Landwirtschaftsamt erhielt
bessere Noten. Der FBV hatte die Medien im Hof der Grossfamilie
Clément in Prez-vers-Siviriez zusammengerufen.
2014 sind die Direktzahlungen für die Freiburger
Bauern um drei Prozent gesunken. Sie können 2015 von
Landschaftsqualitätsbeiträgen (LQB) profitieren, die einen
Teil der wegfallenden Direktzahlungen kompensieren sollen. Dafür
wurden drei Trägervereine gegründet: Sense-See, Glane-Saane
und Greyerz-Vivisbach. Drei weitere Projekte werden aufgegleist. Zwar
bleibe der Gesamtbetrag etwa gleich hoch, so Glauser, doch «wir
müssen mehr leisten dafür, was heisst, dass wir weniger
erhalten». Der Staatsrat erklärte sich im Grossen Rat
bereit, den kantonalen Anteil auf zehn Prozent des Elf-Millionen-Pakets
zu erhöhen (die FN berichteten). Glauser hielt aber fest, dass die
Bauern lieber bessere Verkaufserlöse hätten als höhere
Staatsbeiträge.
Mehr Bürokratie
Glauser brachte auch gute Nachrichten mit: Das Einkommen
der Schweizer Landwirte sei unter dem Strich um zwölf Prozent
gestiegen. Die Produktion im Kanton Freiburg stieg um 2,9 Prozent, mehr
als doppelt so stark wie der Schweizer Schnitt. Allerdings: Noch immer
weiche das bäuerliche Einkommen von demjenigen vergleichbarer
Berufe ab. Glauser geht von einem Manko von 40 Prozent aus. Auch sei
die Produktion noch weit von den Umsatzrekorden der 1990er-Jahre
entfernt. Von einem höheren Einkommen könne keine Rede sein,
zumal die Politik bei der Agrarproduktion die Qualität der
Quantität des Ertrages vorziehe, ergänzte FBV-Direktor
Frédéric Ménétrey.
Die neuen Verfahren führten zudem zu einem
grösseren Verwaltungsaufwand für die Bauern und die
zuständigen Amtsstellen, fuhr Glauser fort. Nach einem harten
Arbeitstag verbringe der Bauer den Abend oft noch im Büro.
«Das ist inakzeptabel.» Denn der Bundesrat habe
versprochen, die Bürokratie zu reduzieren. «Dieses Ziel
wurde deutlich verfehlt und die Situation hat sich verschlimmert.»
Kleinere Staatsbeiträge?
Mit Sorge schaut der FBV auf die laufende Budgetsession
der eidgenössischen Räte. Der Bundesrat wolle die Mittel
für die Landwirtschaft um 128 Millionen Franken kürzen, so
Glauser. «Das wäre ein Wortbruch.» Denn der Bund habe
Streichungen im Agrarsektor ausgeschlossen, um ein Referendum der
Bauern zu verhindern. Es sei am Parlament, so Glauser, diesen Fehler zu
verhindern. Laut Isabelle Barras, Präsidentin der
französischsprachigen Landfrauen, wäre die Reduktion der
Beiträge ein Akt der Geringschätzung der bäuerlichen
Familien und ihrer Arbeit. Nach dem für die Bauern positiven
Entscheid des Nationalrates gestern (siehe Bericht Seite 28) haben die
Bauern Grund zur Hoffnung.
Neben den staatlichen Interventionen ist der Marktpreis
ein wichtiges Element des bäuerlichen Einkommens. Die
Agrarmarktpreise seien gesunken und der Ausblick für die Zukunft
sei düster, so Direktor Ménétrey. «Ich
bezweifle, dass der Wert der Agrarprodukte schnell und signifikant
erhöht werden kann.» Das Einkommen der Bauern stehe also
weiter unter Druck. Dies wiederum fördere den Rückgang der
Zahl der Betriebe im Kanton. Erstmals sank diese unter 3000 auf noch
2973, ein Rückgang um zwei Prozent.
Niedrigere Preise in der EU und die Liberalisierung
verschiedener Märkte sprächen schliesslich für weiter
sinkende Preise, schloss Ménétrey, auch wenn die
Schweizer Bauern in einzelnen Bereichen Kosten einsparten.
Agrarpolitik: «Die besten Böden schützen»
P ierre Julien von der landwirtschaftlichen
Beratungsstelle Agridea erläuterte den Mitgliedern des
Freiburgischen Bauernverbandes anlässlich ihrer gestrigen
Generalversammlung in Siviriez das Vorgehen bei der Erstellung des
Inventars von Flächen, die als Fruchtfolgeflächen anerkannt
werden könnten. Bis jetzt wurden nur Flächen unter 800 Metern
Meereshöhe und einer Hangneigung von 15 Prozent
berücksichtigt. Die Richtlinien des Bundes erlaubten nun, bei der
Hangneigung bis auf 18 Prozent zu gehen. Die Erhebungen zeigten, dass
1104 Hektaren den neuen Kriterien entsprechen würden.
Wie Landwirtschaftsdirektorin Marie Garnier
ausführte, könnten Fruchtfolgeflächen künftig nur
noch für wichtige Projekte im Interesse der Allgemeinheit
überbaut werden. Die Polemik bezüglich Gewässerschutz
sei nicht gerechtfertigt, hielt Garnier weiter fest. Damit rief sie
Ueli Minder, Jeuss, Präsident eines Wasserbauprojektes im Seeland,
auf den Plan. Dass 20 Hektar bestes Kulturland für die
Revitalisierung von Flussläufen geopfert werden sollen,
bezeichnete er als katastrophal. ju
Autor: Fahrettin Calislar
Freiburger Gemeindeverband | 10.11.2014
Die Gemeinden wollen unterstützt werden

Die Gemeinde Crésuz muss Rückzonungen vornehmen und hat deswegen Sorgen.Bild Julien Chavaillaz/a
Die Moratorien bezüglich Revision der
Ortsplanungen und Fruchtfolgeflächen setzen die Gemeinden unter
Druck. Sie möchten deshalb vom Staatsrat unterstützt werden,
wie dies an der Versammlung des Freiburger Gemeindeverbandes am Samstag
in Cugy zum Ausdruck kam.
Mehrmals ist der FreiburgerGemeindeverband (FGV)
beimStaatsrat und der Raumplanungsdirektion vorstellig geworden, wie
die neue Verbandspräsidentin Nadia Savary an der
Generalversammlung vom Samstag in Cugy sagte. Nebst der Revision der
Ortsplanungen gelte es, auch Fragen der Rückzonungen und der
Entschädigungen der Landbesitzer zu klären und
vernünftige Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Vor allem
erhofft sie sich auch moralische Unterstützung, da die Gemeinden
von den Bürgerinnen und Bürgern bedrängt werden.
Der Fall Crésuz
Dass die Gemeinden unter Druck geraten, bestätigte
an der Versammlung auch Didier Bütikofer, Ammann von
Crésuz. Nach seinen Worten ist seine Gemeinde von einer
Rückzonung und von Entschädigungsfragen der Landbesitzer
betroffen. «Was tun?», wollte er vom Staatsrat vernehmen.
Der zuständige Baudirektor Maurice Ropraz –
der Staatsrat war in corpore in Cugy – ist sich der Problematik
bewusst. Wie er sagte, hat der Kanton Freiburg in den letzten zehn
Jahren netto mehr Rückzonungen vorgenommen als neue Bauzonen
geschaffen. «Mir ist kein Fall von Entschädigungen bekannt.
Man hat sich jeweils geeinigt», führte er aus. Jetzt
müsse aber rasch das Gesetz geändert werden, damit bei
Neueinzonungen ein Mehrwert abgeschöpft werden kann, der in einen
Fonds für solche Entschädigungen fliesst. Diese
Mehrwertabschöpfung soll bereits ab 2016 in Kraft treten. Zudem
müsse der kantonale Richtplan revidiert werden, damit der
Bundesrat ihn im Jahre 2017 genehmigen kann.
Er gab auch bekannt, dass Anfang nächsten Jahres in
allen Bezirken Informationsveranstaltungen zur ganzen Problematik
stattfinden werden, die öffentlich sind. Weiter sagte er den
Gemeinden seine Unterstützung zu. «Gemeinsam können wir
diese Herausforderungen meistern», gab sich Ropraz überzeugt.
Für Fristenverlängerung
Was die Gemeindefusionen betrifft, so will der
Gemeindeverband erreichen, dass die Frist für das Einreichen von
Fusionsprojekten nicht schon Ende Juni 2015 abläuft, sondern erst
fünf Jahre später. Die FDP-Grossrätin Nadia Savary hat
eine entsprechende Motion eingereicht. Wie sie sagte, braucht es vor
allem für Grossfusionen mehr Zeit. Sie erinnerte auch an die
Unterstützung, die der FGV fusionswilligen Gemeinden leisten kann.
Unter der Leitung der Generalsekretärin Michelin Guerry betreut
ein Beratungsteam solche Gemeinden. «Gegenwärtig betreuen
wir 15 Projekte, welche 76 Gemeinden umfassen», betonte sie.
Bereits in der kommenden November-Session wird der Grosse Rat eine
Motion von ihr und von CVP-Grossrat Yves Menoud behandeln, welche
verlangt, dass die Gemeindewahlen für Gemeinden, deren Fusion am
1. Januar 2017 in Kraft tritt, erst danach erfolgen.
Kriterien werden analysiert
Nadia Savary wies an einer vorgängigen
Pressekonferenz auch darauf hin, dass die Kriterien für den
Bedarfsausgleich im Rahmen des neuen interkommunalen Finanzausgleichs
analysiert werden. Vor allem werde dabei untersucht, wie sich Kriterien
wie die Länge der Gemeindestrassen, die Sozialhilfe sowie die
Schülertransporte auf den Bedarfsausgleich auswirken. Besonders
die grossen Gemeinden mit vielen Gemeindestrassen fühlen sich
heute benachteiligt.
Einen Dauerbrenner bildet die neue Aufgabenteilung
zwischen Kanton und Gemeinden. «Es gelte, jede Aufgabe zu
analysieren, immer mit Blick auf das Subsidiaritätsprinzip und auf
das Prinzip ‹Wer befiehlt, zahlt›», sagte Savary
und gab zu verstehen, dass die Gemeinden, die den Bürgerinnen und
Bürger sehr nahestehen, auch alle Aufgaben übernehmen sollen,
die sie wahrnehmen können. «Es geht um die Stärkung der
Gemeindeautonomie.»
Frimobility gut gestartet
Ein Anliegen des Gemeindeverbandes ist es, dass sich
Pendler zu Fahrgemeinschaften zusammenfinden und bloss mit einem Auto
statt mit drei, vier Autos zur Arbeit fahren. Dasselbe gilt für
Besucher von Grossanlässen. Laut Savary hat sich die Zahl der
eingeschriebenen Personen seit der Lancierung der neuen Plattform www.frimobility.ch
im vergangenen Juli vervierfacht. Dies auch dank der Partnerschaft mit
Groupe E, den TPF und dem Amt für Strassenverkehr und Schifffahrt.
Sie rief denn auch die Oberamtmänner auf, im Bewilligungsverfahren
für Grossanlässe Frimobility miteinzubeziehen.
An der Versammlung mit mehreren Hundert
Gemeindevertretern wurde die Gemeindepräsidentin von Kerzers,
Susanne Schwander, neu als Vertreterin des Seebezirks und als
Nachfolgerin von Erwin Fuhrer, Courtepin, in den Kantonalvorstand
gewählt.
Käthi Thalmann: «Wir sind die Poyabrücke»
G rossratspräsidentin Katharina Thalmann- Bolz
überraschte die Versammlung mit dem Zitat: «Wir sind die
Poyabrücke.» Mit «Wir» meinte die
Gemeinderätin von Murten allerdings die Gemeinden und nicht den
Grossen Rat. «Es sind die Gemeinden, die Brücken zwischen
den Sprach- und Kulturgemeinschaften, zwischen den Gemeinden und dem
Kanton bauen und für ein starkes Image des Kantons Freiburg
besorgt sind. «Die Gemeinden sind aber manchmal auch die
Ärzte des Kantons», hielt sie fest und versicherte, dass die
Grossräte stets nur das Wohl des Kantons im Auge haben.
Staatsrätin Marie Garnier erklärte, sie sei
sich bewusst, dass die Beziehung der Gemeinden zum Kanton nicht immer
eine Liebesgeschichte sei. Sie rief aber die Gemeinden auf, aktiv zu
sein und mit anderen Gemeinden und dem Staat zusammenzuarbeiten. So
setzte sie sich für ein regionales Zusammengehen ein, wenn es
gelte, grosse Projekte zu realisieren. «Der Staat braucht diese
Dynamik der Gemeinden», sagte sie.
Visionen entwickeln
Auch die Gastreferentin Christa Perregaux Dupasquier,
Vizedirektorin der Vereinigung für Landesplanung, zeigte auf, dass
die Gemeinden mit einer aktiven Bodenpolitik Visionen realisieren und
die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger
erhöhen können. «Bei einem Landkauf kann die Gemeinde
mehr Einfluss nehmen, zum Beispiel bezüglich verdichtetes
Bauen», sagte sie und gab zu bedenken, dass nicht nur das
Eigentumsrecht zähle, wenn Landbesitzer nicht verkaufen wollen,
sondern auch das Raumplanungsgesetz und die nachhaltige Entwicklung. az
Autor: Arthur Zurkinden
Kanton darf Ackerflächen neu berechnen

Ackerland ist wertvoll. In
Notlagen und Krisen müsste es die Versorgung des Landes mit
Nahrungsmittel gewährleisten können.Bild ca/a
Der Bund schreibt den Kantonen eine
Mindestmenge von besonders wertvollem Ackerland vor. Freiburg erreichte
diesen Wert bisher nicht. Doch nun haben Bund und Kanton vereinbart,
dass Freiburg seine Flächen neu bewerten darf. Dann wird die
Rechnung wohl aufgehen.
Eine gute Nachricht für die Gemeinden und die
Raumplanung im Kanton Freiburg: Bund und Staatsrat haben eine
Neubewertung der landwirtschaftlich wertvollen Böden, den
sogenannten Fruchtfolgeflächen (FFF, siehe Kasten), vereinbart.
Dies schreibt der Staatsrat in einer Mitteilung. Die Aktualisierung
ermögliche den Schutz des Ackerlandes und zugleich dessen Nutzung
im Einklang mit den raumplanerischen Vorgaben des Bundes an die
Kantone. Denn die bisherigen Erhebungen hatten für Freiburg immer
zu geringe Flächen ausgewiesen.
Der Bund hat dem Kanton Freiburg eine Mindestfläche
von 35 800 Hektaren hochwertiger Ackerfläche vorgeschrieben.
Nach der alten Rechenmethode lag Freiburg um 236 Hektaren darunter.
Falls der Bund die überarbeiteten Analysemethoden des Kantons
bestätigt, kann Freiburg die Flächen neu berechnen.
Wie Landwirtschaftsdirektorin Marie Garnier auf Anfrage
ausführte, sei zu erwarten, dass der modifizierte Wert höher
liegt als der früher ausgerechnete. «Wir haben damals den
guten Schüler gespielt und bei der früheren Erhebung
strengere Kriterien als die übrigen Kantone angewandt.»
Einzonen wieder möglich
Die direkte Folge des Abkommens: Sobald der Kanton
Freiburg die gesetzlich vorgegebene Fläche erreicht und
überschritten hat, können FFF unter Umständen eingezont
und in der Folge bebaut werden. Wie Garnier betont, sind die
Einschränkungen eng: Der vorgesehene Bau muss ein Projekt von
bedeutendem öffentlichem Interesse sein und dem Prinzip des
verdichteten Bauens entsprechen. Zudem darf die Einzonung nicht dazu
führen, dass die Fläche wieder unter den Mindestwert
fällt.
Unter den aktuellen Bedingungen der zweifelhaften
Legitimität unterstehen die Freiburger FFF einem absoluten Schutz
des Bundes. Das heisst, neue Einzonungen sind unter keinen
Umständen möglich, selbst dann nicht, wenn entsprechende
Kompensationen geleistet werden. Der Kanton Freiburg will die Vorgaben
des Bundes einhalten, betont der Staatsrat in einer Mitteilung.
Warten bis zum Entscheid
Staatsrätin Garnier hofft, dass das Problem bald
gelöst werden kann. Im Laufe dieser Woche stellt eine Freiburger
Delegation den zuständigen Bundesämtern die neue
Erhebungsmethode vor.
So sehr die Vereinbarung auch Anlass zur Hoffnung
für viele Gemeinden gibt–einige könnten in
Schwierigkeiten kommen. Betroffen sind Gemeinden, die ihre Ortsplanung
revidieren und entsprechend dem bis zum Erlass des neuen kantonalen
Richtplans geltenden Moratorium Einzonungen von FFF im Austausch gegen
Kompensationen vorhaben. Ihnen empfehle er, zu warten und das Verfahren
auszusetzen, bis das Resultat der neuen Erhebung bekannt ist, hält
Raumplanungsdirektor Maurice Ropraz fest. Ansonsten drohe die
Ortsplanung wegen der Vorgaben des Bundes durch Beschwerden blockiert
zu werden. Betroffen seien aber nicht viele Gemeinden.
Definition
Warum Ackerland geschützt wird
Der Bund schreibt in seinem Sachplan
Fruchtfolgeflächen (FFF) jedem Kanton eine Mindestfläche
für Kulturland vor. Der Schutz der FFF dient unter anderem dazu,
bei Notlagen und Krisen die Versorgung der Bevölkerung mit
landwirtschaftlichen Produkten zu sichern. Die FFF bieten die besten
Bedingungen für den Ackerbau und sind der agronomisch besonders
wertvolle Teil der für die Landwirtschaft geeigneten Gebiete der
Schweiz, umschreiben die beiden gleichermassen zuständigen
Direktionen für Raumplanung und Landwirtschaft in ihrer
gemeinsamen Mitteilung. Für den Kanton Freiburg sind 35800 Hektare
FFF vorgesehen, was etwas weniger als der Hälfte der gesamten
landwirtschaftlich genutzten Fläche im Kanton entspricht.
Bauernvertreter und Grossräte hatten Anfang Jahr den Staatsrat
aufgefordert, für das Problem eine Lösung zu finden.fca
Autor: Fahrettin Calislar
2014
Mit
der Poyabrücke und dem Transittunnel direkt auf die A12 ist
automatisch eine resultierende Umfahrung von Düdingen entstanden!
 
2006
Mit
der Poyabrücke und dem Transittunnel auf die A12
erhalten wir alle automatisch eine Umfahrung von Düdingen!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Warum finanziert der Bund die "sogenannte Umfahrung" mit keinem Franken?
Warum wurde diese von der Agglomeration auf Stufe C zurückgestellt?
Warum wurde diese vom Kanton auf Stufe III und und Platz 14
von 26 geprüften Umfahrungsplanprojekten positioniert?


Fakten & Analysen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Poyabrücke ist am 12. Oktober 2014 eröffnet worden.
Der mittlere und obere Sensebezirk hat
somit direkten und schnellen Zugang zur Autobahn A12!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eingabe VoVD am 23. März 2013 an den
Gemeindeverbandes des Sensebezirkes zur RP 2030!
Fakten & Auswirkungen werden aufgezeigt
Ökologische und Nachaltige Lösungsschritte werden präsentiert


Dossier auf Anfrage
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2010
So funktioniert der St.
Leonhard Kreisel
überirdisch
und unterirdisch
Der Verein
VoVD hat da, dank seiner
Einsprache Massgeblich mitgewirkt!
2006
Verkehrszahlen und damaliger Einfluss der Poyabrücke
vor
der nachhaltigen unterirdischen Transitlösung für den
Sensebezirk!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!! Stellungnahme des
VoVD zu Verkehrsstudie unterer Sensebezirk !!
Autobahnanschluss in Friseneit oder Fillisdorf.
zu der Verkehrsstudie unterer
Sensebezirk
Stellungnahme Freiburger
Nachrichten 01.05.2009
Stellungnahme La
Liberté 29.04.2009
Stellungnahme BZ 30.04.2009
**Verkehrsstudie
unterer Senesebezirk**
2007
Überlegungen zur
geplanten Umfahrung von Düdingen
und zu einem möglichen Autobahnanschluss in
Fillistorf
An die Einwohner einiger
Quartiere von Düdingen
Wieviele
Düdinger würden die geplante
V2 Umfahrung selber nutzen können ?
2004
Stellungnahme IGoVD zuhanden
Gemeindeverband Region Sense
Bewilligungskriterien
für Autobahnanschlüsse
Quelle Interpellation von Frau
Laumann-Würsch Helen
2002
Arbeitsgruppe
(IGoVD)
*
Auswirkungen und Vorbehalte
zu der Umfahrung auf Düdingen *

|
|














 Stellungnahme
Stellungnahme